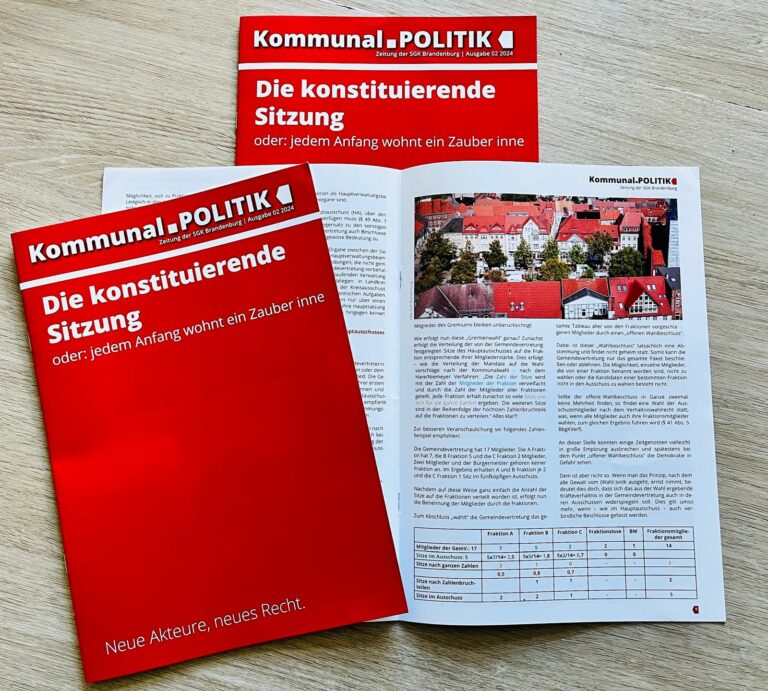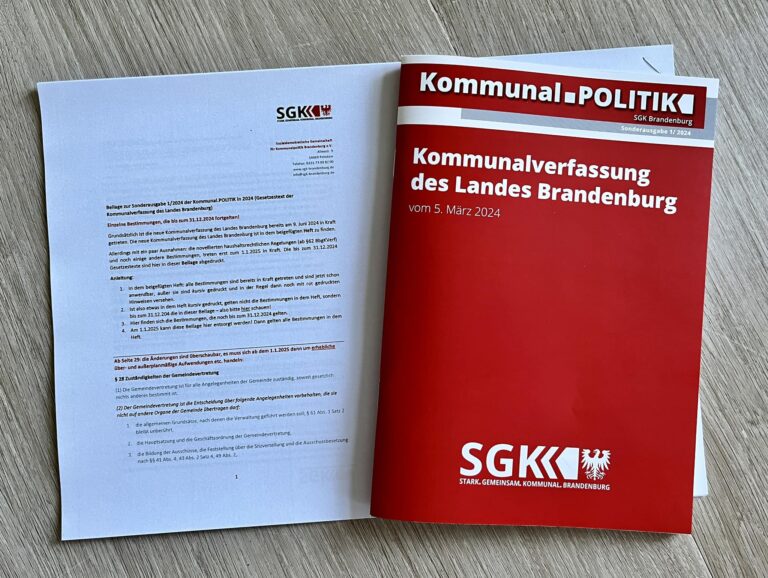27. Oktober 2022 ab 18 Uhr Nachgefragt! Die sozialen Folgen der Energiewende Gespräch mit Brigitte Meier, Beigeordnete der Stadt Potsdam (Online)
Kaum ein Thema wird so engagiert diskutiert wie die Energieversorgung! Kommen gegenwärtig noch besondere Herausforderungen hinzu, ist gerade die Energiewende ohnehin ein Thema, das ebenso motiviert angegangen wird wie sie kontrovers diskutiert wird. Bei allen positiven ökologischen und durchaus auch ökonomischen Auswirkungen hat die Energiewende jedoch auch soziale Konsequenzen. Was bedeutet das für die Kommunen im Land Brandenburg? Wir freuen uns, dass Brigitte Meier, Beigeordnete der Stadt Potsdam und für Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit zu diesem Thema für ein Gespräch zur Verfügung steht!
Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung:
https://www.sgk-brandenburg.de/veranstaltung/nachgefragt-die-sozialen-folgen-der-energiewende-gespraech-mit-brigitte-meier-beigeordnete-der-stadt-potsdam/
29.Oktober 2022 9.30 bis 13 Uhr (Präsenz!) Bauen und Planen – kommunales Bauland entwickeln
Ort: Seminarhaus Havelland, Werderdammstraße 9, 14669 Ketzin OT Paretz
Bauland, insbesondere das kommunale, ist eine endliche Ressource. Umso wichtiger ist es, es optimal zu nutzen. In dieser Veranstaltung sollen die Grundlagen, die Möglichkeiten aber auch die Grenzen für die Kommunalpolitik bei der Bauflächenentwicklung gegeben und Alternativen aufgezeigt werden. Wir freuen uns dafür als Referentin Kathrin Pollow, Leiterin des Stadtplanungsamtes und Fachbereichsleiterin Bauleitplanung der Stadt Falkensee, gewonnen zu haben, die sowohl mit den theoretischen Grundlagen als auch mit der praktischen Umsetzung vertraut ist.
Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung:
https://www.sgk-brandenburg.de/veranstaltung/bauen-und-planen-praesenzseminar/
1.November 2022 18.00 bis 21.00 Uhr Rechtssicher per Video tagen! Videositzungen in den kommunalen Vertretungen – § 34 Absatz 1 a der Brandenburger Kommunalverfassung verständlich gemacht (Online)
Vieles musste in den letzten Jahren in den kommunalen Vertretungen diskutiert werden, oftmals war aber schon die Frage: wie darf man eigentlich tagen? Mit der jüngsten Änderung der Kommunalverfassung hat der Gesetzgeber auch außerhalb einer Notlage die Videoteilnahme an den Sitzungen kommunaler Gremien ermöglicht. Die Regelung in § 34 Abs. 1a BbgKVerf wirft in ihrer Anwendung und Handhabung allerdings mehr Fragen auf, als sie beantwortet. Darunter etwa wann ein begründeter Antrag auf Videoteilnahme vorliegt, wie die Sitzung technisch umzusetzen ist, welche Anforderungen gelten im Hinblick auf den Grundsatz der Öffentlichkeit und wie funktionieren geheime Wahlen per Video?
Die beiden erfahrenen Kommunalpolitiker Tobias Schröter, vielen bereits aus den Seminaren zum Kommunalrecht bekannt, und Georg Hanke, Vorsitzender des Kreistages des Landkreises Dahme-Spreewald, werden einen Überblick geben, was man wissen muss und was zu beachten ist.
Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung:
https://www.sgk-brandenburg.de/veranstaltung/rechtssicher-per-video-tagen-videositzungen-in-den-kommunalen-vertretungen-%c2%a7-34-absatz-1-a-der-brandenburger-kommunalverfassung-verstaendlich-gemacht/
10.und 16. November 2022) – jeweils 17.30 – 20.00 Uhr Kindertagesstätten in den Kommunen Brandenburgs – Grundlagen und Finanzierung (2teilige Veranstaltung!, Online)
Eine gute und zuverlässige und gute Kindertagesbetreuung für unsere Jüngsten in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege ist eine der wichtigsten Aufgaben der Daseinsvorsorge. Zahlreiche Diskussionen in den letzten Jahren haben aber auch deutlich gemacht, dass es gar nicht so einfach ist, die Rahmenbedingungen, die rechtlichen Grundlagen, die Zuständigkeiten, die Finanzierung sowie die Umsetzung in den Kommunen zu kennen und zu verstehen. Wichtig ist das aber nicht nur für die Eltern, sondern insbesondere auch für die hauptamtlich und ehrenamtlich Verantwortlichen in den Kommunen Brandenburgs, müssen sie doch bei zahlreichen Gelegenheiten Entscheidungen treffen, die die Betreuung der Kleinsten betreffen. Dafür sind Kenntnisse erforderlich, die in diesem zweiteiligen Online-Seminar vermittelt werden sollen.
Wie sind eigentlich die bundesrechtlichen Regelungen, die landesspezifischen Strukturen und wo liegen die konkreten Zuständigkeiten? Wer ist für die Bedarfsplanung zuständig und wie kann die Qualität sichergestellt und weiterentwickelt werden? Welche Regelungen gelten für die Fachkräfte und wie mit dem Fachkräftemangel umgehen? Wie steht es um die Kalkulation der Elternbeiträge? Was ist möglich, was ist sinnvoll und was geht vielleicht auch nicht? Wie werden die Eltern ab dem 1. Januar 2023 wegen der Energiekrise voraussichtlich zusätzlich durch Beitragsbegrenzungen entlastet? Gegenstand der Veranstaltung wird das geltende Kita-Recht in der Fassung, die aktuell und im nächsten Kita-Jahr 2023 / 2024 (voraussichtlich) gelten wird, sein. Diese und weitere Fragen werden wir mit Volker-Gerd Westphal (Leiter der Abteilung für Kinder und Jugend, überörtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg) erörtern können!
Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung:
https://www.sgk-brandenburg.de/veranstaltung/online-kindertagesstaetten-in-den-kommunen-brandenburgs-grundlagen-und-finanzierung-2teilig/
16. November 2022 17.30 – 18.30 Uhr Nachgefragt: Was gibt es Neues im Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und
Bauwesen? – Gespräch mit Annett Jura (Abteilungsleiterin im BMWSB) (Online)
Wohnen ist ein Thema, das jeden angeht! Nur weniges auf der bundespolitischen Ebene ist für die Kommunen und ihre Bürgerinnen und Bürger so relevant, wie die Themen Bauen und Wohnen. Ist doch die Lage in den Kommunen im Land Brandenburg sehr unterschiedlich. Von dicht besiedelten Gebieten bis hin zu Regionen, die als „unbesiedelt“ gelten, ist alles dabei und die meisten Regionen liegen irgendwo dazwischen. Die Herausforderungen beim Bauen von Wohnungen, die Chancen der Planungsbeschleunigung, die Novelle des Baugesetzbuches, die Wohngeldnovelle, der Heizkostenzuschuss, die Wohnungslosigkeit, die neue Wohngemeinnützigkeit und nicht zuletzt die Finanzhilfen des Bundes, im Zusammenhang mit der Erbringung von Eigenanteilen der Kommunen sind alles Themen, die auch die haupt- und die ehrenamtlich Verantwortlichen in der kommunalen Ebene Brandenburgs bewegen.
Annett Jura, Abteilungsleiterin im Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen und Mitglied im Vorstand der SGK Brandenburg, gibt Auskunft zu den gegenwärtig relevanten Themen. Bringt sie doch, aus ihren Jahren als Bürgermeisterin der Rolandstadt Perleberg, eigene Erfahrungen mit, wie es um das Wohnen in Brandenburg bestellt ist. Wir freuen uns, dass sie für ein Gespräch zur Verfügung steht und laden dazu alle Interessierten herzlich ein!
Anmeldungen zu dieser Veranstaltungen sind bis zum 15.11.2022 und ausschließlich wie folgt möglich: per Telefon unter 0331/730 98 200 (Anrufbeantworter außerhalb der Bürozeiten) oder per E-Mail an info@sgk-brandenburg.de
17. November 2022 – Vorankündigung! Nachgefragt! – Gespräch mit Katja Poschmann, Mitglied des Landtages Brandenburg (Online) Vorankündigung! Weitere Informationen folgen!
18. November 2022 18.00 – 20.30 Uhr Vergaben und Compliance in den Kommunen Brandenburgs Online
Wer ist der größte Investor im Land? Der Bund, die Länder? Es sind die Kommunen! Dabei geht es um viel öffentliches Geld. Wird in der Kommune investiert, sind in der Regel auch Aufträge zu vergeben – nicht nur für Bauleistungen, wenn ein kommunales Gebäude errichtet werden soll, sondern auch in zahlreichen anderen Gebieten – vom der Umsetzung des Digitalpaktes für Schulen bis hin zur Beschaffung von Dienstfahrzeugen oder Feuerwehrtechnik. Das stellt nicht nur die hauptamtlich Verantwortlichen in den kommunalen Verwaltungen vor Herausforderungen, auch die kommunalen Vertretungen beschäftigen sich damit. Dabei sind die Grundlagen und die Verfahren nicht immer ganz leicht zu verstehen. Hier soll das Seminar Abhilfe schaffen. Gleichzeitig müssen sich haupt- und ehrenamtlich für die Kommune Tätige nicht nur bei den Vergaben, sondern auch im täglichen Umgang mit den Bürgerinnen und Bürgern an Recht und Gesetz halten. Wenn es um einen begehrten Kita-Platz geht, ein Termin im Bürgeramt schneller zu haben sein soll, oder ein Verwandter eine Genehmigung braucht. Vorteilsannahme- und –gewährung, Bestechung, bzw. Bestechlichkeit sind keine Kavaliersdelikte. Aber was bedeutet es eigentlich, wenn von Compliance die Rede ist? Welche Anforderungen sind zu erfüllen? Welche Vorgaben sind einzuhalten? Und was passiert, wenn Regeln nicht eingehalten werden?
Wir freuen uns, dass Dr. Harald Sempf (Dezernent des Dezernates Recht, Allgemeine und Finanzverwaltung der Stadt Falkensee) und Mathias Techen (Leiter des Amtes für Bürgerdienste, Stabstellenleiter Vergabemanagement sowie Wahlleiter der Stadt Falkensee) für dieses Seminar und einen Austausch zur Verfügung stehen! Dieses Seminar ist für alle Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler in den Kommunen, aber auch hauptamtlich Verantwortliche und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den kommunalen Verwaltungen geeignet.
Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung:
https://www.sgk-brandenburg.de/veranstaltung/online-vergaben-und-compliance-in-den-kommunen-brandenburgs/
19. November 2022 – Vorankündigung! Verwaltungsrecht für Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker – mit Dietlind Biesterfeld, Beigeordnete des Landkreises Teltow-Fläming
Ort: GINN Hotel, Warthestraße 20, 14513 Teltow
Vorankündigung! Weitere Informationen erfolgen zeitnah!
Wir freuen uns über Anmeldungen:
- per Telefon unter 0331/730 98 200,
- per E-Mail über info@sgk-potsdam.de oder
- (soweit angegeben) über unsere Homepage (sgk-brandenburg.de) unter „Veranstaltungen“